Search
Die republikanischen Otiumvillen von Tivoli
2012
22.0 x 29.0 cm, 256 p., 139 illustrations b/w, paperback / softback
ISBN: 9783895008757
22.0 x 29.0 cm, 256 p., 139 illustrations b/w, paperback / softback
29,90 €
ISBN: 9783895008757
Short Description
The territory of the rural Latin town of Tibur (Tivoli) constituted one of the most important sites of Roman villa culture in the Republican period. In the summertime, Roman senators were attracted by the cool atmosphere of the Tiburtine slopes in order to escape the bad climatic and narrow spatial conditions in Rome. In his study, Martin Tombrägel discusses the architectural genesis of the earliest Roman otium-villas at Tivoli. A series of imposing elite residences were built here from the early 2nd century B.C. Construction employed the new medium of concrete, and this allowed for the development of adventurous architectural forms. This study offers a comprehensive analysis of the architectural history of the luxury villa. It also probes the origins of this fascinating building type in its social-historical context.Description
No english description available. Showing german descriptionIm Zuge einer bautechnischen, architektonischen und historischen Auseinandersetzung mit den ländlichen Wohnsitzen des römischen Hochadels aus der Umgebung von Tivoli konnten weitreichende neue Ergebnisse erzielt werden.
Die bautechnische Untersuchung ergab die Datierung der tiburtinischen Otiumvillen in das 2. Jahrhundert v. Chr. Es zeigte sich außerdem, dass sich beinahe die gesamte architektonische Entwicklung der dortigen Otiumvillen, von denen 60 Beispiele behandelt wurden, noch im 2. Jahrhundert v. Chr. vollzieht und die gewaltigen Caementicium-Otiumvillen sogar schon mit der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verbunden werden müssen.
Im Rahmen der weiterführenden wissenschaftlichen Analyse gelang es, die architektonische Genese der Bauform Otiumvilla von Beginn an nachzuzeichnen und dabei auch zum ersten Mal zu klären, wodurch sich eine republikanische Otiumvilla topographisch und architektonisch überhaupt definiert. Nach tiburtinischer Version liegt deren architektonischer Startpunkt in der deutlichen räumlichen Trennung von zwei unterschiedlichen Lebensbereichen und wird im Rahmen der Hangvillen durch die horizontale Unterscheidung eines oberen Wohn- und eines unteren Gartenbereichs ausgedrückt. Das Ziel der architektonischen ‚Otiumvillen-Idee’ besteht einerseits in der Nobilisierung eines gesonderten Wohnbereichs und andererseits in der Schaffung eines weitläufigen Gartenbereichs. Die Umsetzung dieser Otiumvillen-Idee enthält die praktische Ausgestaltung der horizontalen Villenaufteilung mit den Mitteln der Caementicium-Bauweise, wobei unter anderem der neue Baukörper der basis villae in die Otiumvillenarchitektur eingeführt wird. Im Vergleich mit der konkreten architektonischen Verbesserung der luxuriösen Wohnumstände spielen die Fragen nach der repräsentativen Außenwirkung und des baukünstlerischen Gesamteindrucks bei den frühesten tiburtinischen Otiumvillen nur eine untergeordnete Rolle. Hier zeigt sich ein Unterschied zu den Otiumvillen aus der Umgebung von Sperlonga, bei denen die Außenwirkung zu den ursprünglichen Gestaltungszielen zählt. Die architekturhistorische Auseinandersetzung ergab als übergeordnetes Resultat, dass der privaten Villenarchitektur im Rahmen der mittelitalischen Caementicium-Baukunst sowohl in Bezug auf Innovationsabläufe als auch auf Bauvolumina gegenüber der vergleichbaren sakralen und staatlich-repräsentativen Architektur ein deutlich höherer Stellenwert eingeräumt werden muss als bisher geschehen.
Die weitreichendsten wissenschaftlichen Auswirkungen der archäologischen Ergebnisse betreffen die historische Einordnung des republikanischen Otiumphänomens. Es konnte gezeigt werden, dass die archäologische Datierung der megalomanen Caementicium-Otiumvillen Tivolis in die erste Hälfte des 2. Jahrhundert v. Chr. den historischen Quellen keineswegs widerspricht, sondern mit diesen gut in Übereinstimmung zu bringen ist. Begreift man das Otiumvillen-Phänomen als transgressives Ausgreifen des römischen Adels über die Normengrenzen des mos maiorum und verbindet damit die Befriedigung des Bedürfnisses nach fürstlichen Wohnumständen außerhalb der stadtrömischen Kontrollinstanzen, so ergibt sich nicht nur, dass ein solches Ausgreifen in der ersten Hälfte des 2. Jahrhundert v. Chr. gut verständlich wird, sondern auch, dass es zwingend mit megalomanen Gesamtausmaßen und luxuriösen Wohnumständen verbunden werden muss.
Biographical Note
Martin Tombrägel1975 geboren in Lohne (Oldenburg)
1995-2000 Studium der Klassischen Archäologie, der Alten Geschichte und der Lateinischen Philologie an den Universitäten Marburg und Freiburg
2001-2004 Doktorandenstipendien des DAAD und der Gerda-Henkel-Stiftung am Deutschen Archäologischen Institut, Rom
2005 Promotion an der Philipps-Universität Marburg im Fach Klassische Archäologie. Titel der Dissertation: „Die republikanischen Otiumvillen von Tivoli“
2005-2006 Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts
2006-2007 Mitarbeiter am Bildarchiv Foto Marburg
2007-2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Archäologischen Institut der Universität Leipzig
Seit 2008 Akademischer Assistent am Archäologischen Institut der Universität Leipzig
Forschungsschwerpunkte: Römische Architektur, Hellenismus, Innovationsforschung



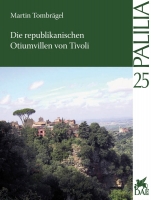
 Preface
Preface

 Neuerscheinungen 2023/2024
Neuerscheinungen 2023/2024
 Gesamtverzeichnis 2023/2024
Gesamtverzeichnis 2023/2024
 Katalog Oriental Studies & Linguistics
Katalog Oriental Studies & Linguistics
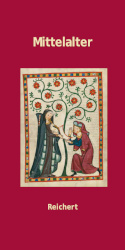 Mittelalter
Mittelalter
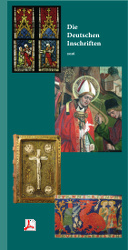 Deutsche Inschriften
Deutsche Inschriften
 Musiktherapie
Musiktherapie
 Literaturen im Kontext
Literaturen im Kontext